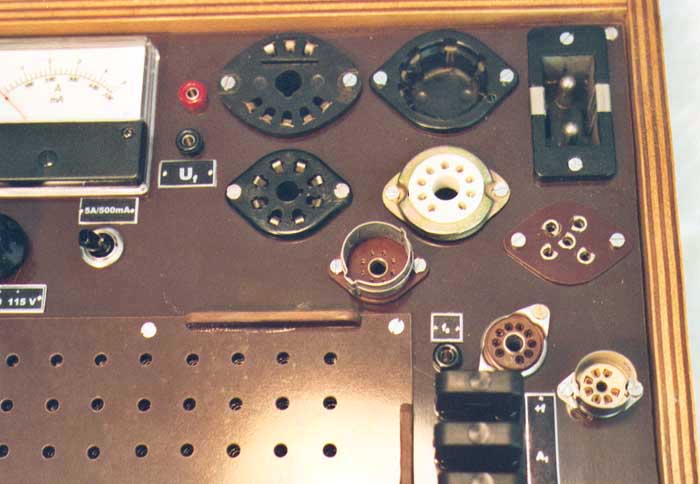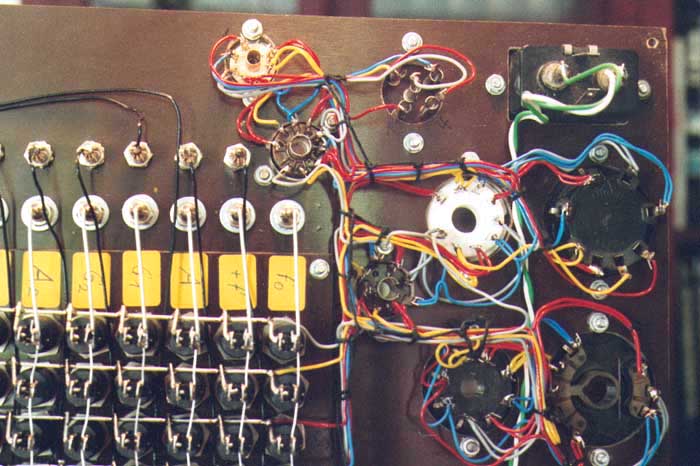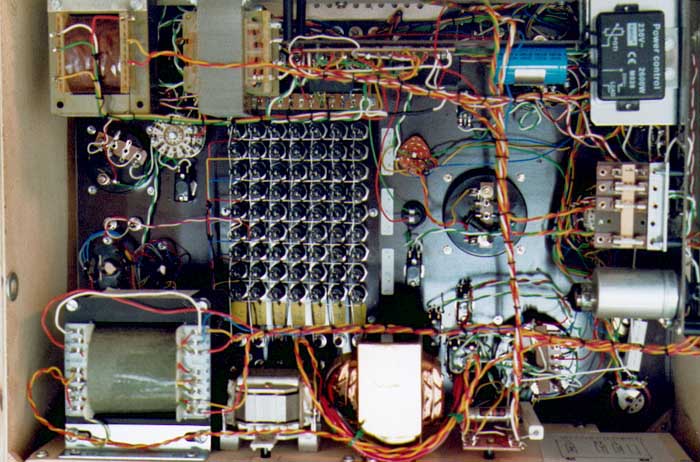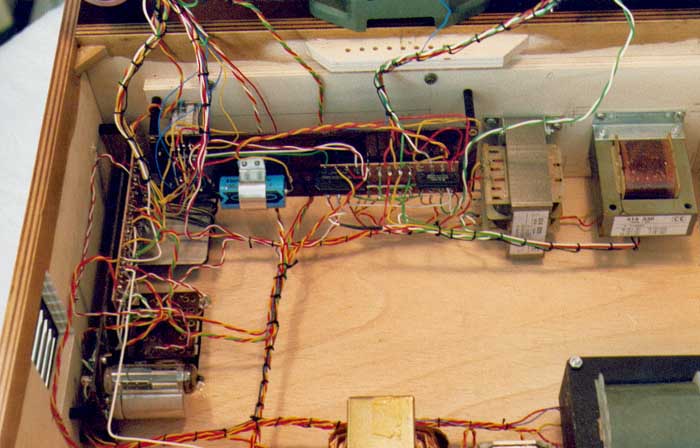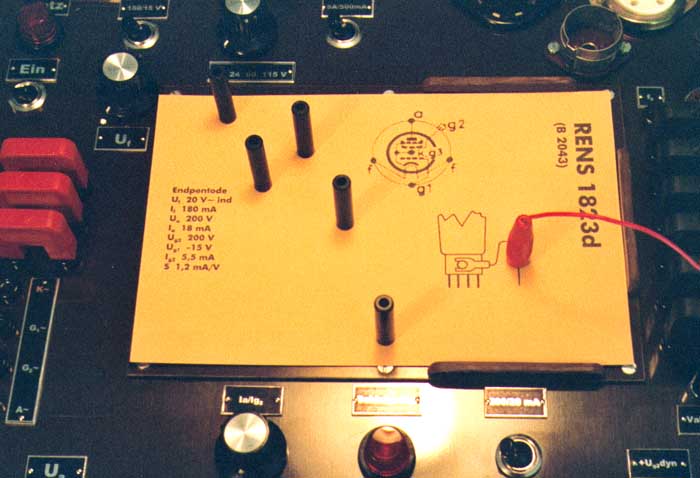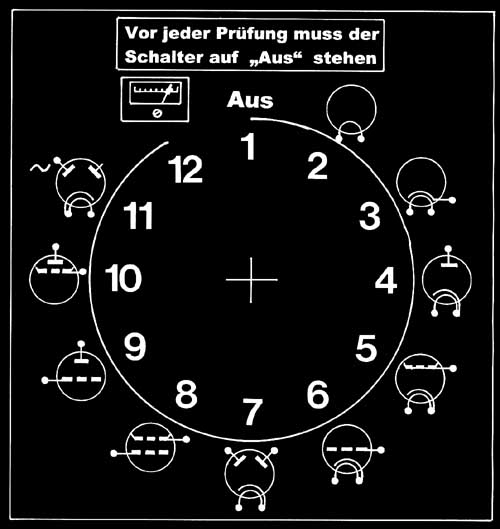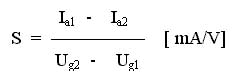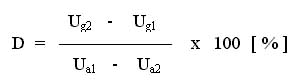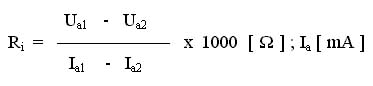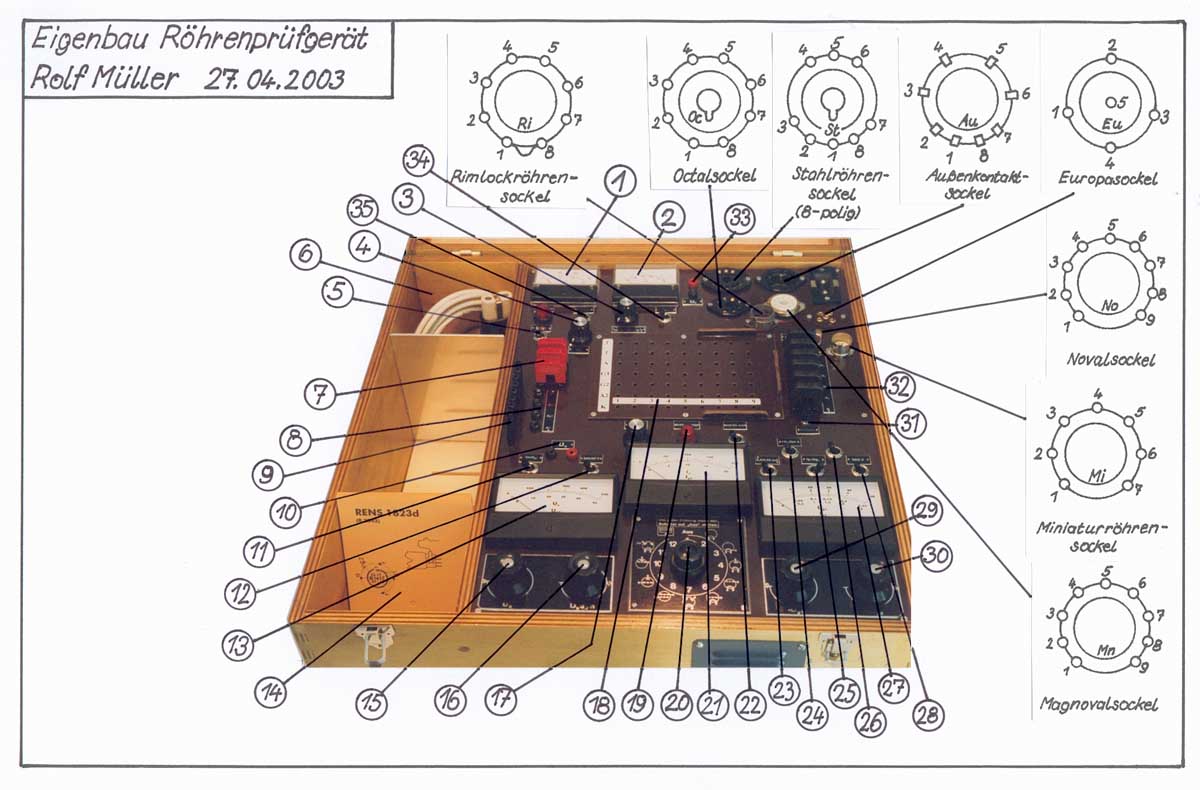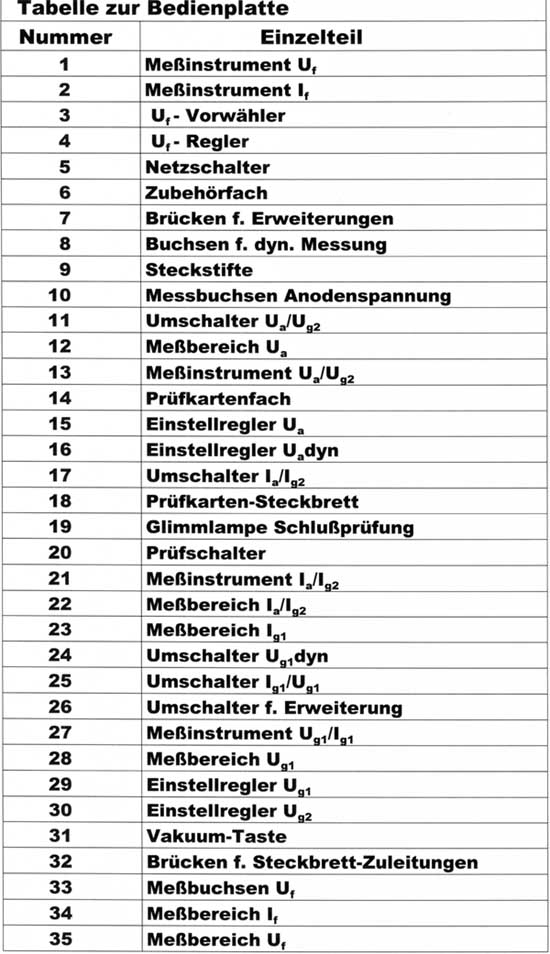Das Röhren-Prüf- und Messgerät "RPG-Müller"
von Rolf Müller
Hinweis ! Diese Seite ist ausschliesslich nur für den privaten und nicht für den
gewerblichen Gebrauch (z.B. Internet-Auktionen !) bestimmt.
Es dürfen keine Fotos und Texte ohne meine vorherige Zustimmung verwendet werden !
Ein Röhrenprüfgerät zu besitzen, reitzte mich schon seit langem. Als ich zu planen begann,
war mir nur die prinzipielle Funktion bekannt, nicht aber genaue Details einer praktischen Ausführung. Käufliche
Geräte z.B. bei ebay erschienen mir im Preis zu astronomischen Summen hochgejubelt.
Der Nachbau eines der "großen" Geräte war mir schon beim Sichten der Schaltpläne viel zu kompliziert.
Doch der Appetit kommt bekanntlich beim Essen! Nach und nach entstand bei mir eine Vorstellung, was das Gerät
können sollte. Das Erstellen von Kennlinien sollte möglich sein, das bloße Prüfen auf "gut" oder
"unbrauchbar" war mir zu wenig. Beim Prüfen von Röhren sollte schon etwas Physik mit im Spiel sein. Das
Literaturstudium und das Sichten von Schaltplänen und Bedienanleitungen ist dabei unerläßlich. Jogis
Röhrenbude half mir hier mit hervorragenden Informationen.
Mein Selbstbau-Gerät enthält Elemente mehrere Beschreibungen von alten Geräten, wie z.B. Funke W 20
und Neuberger RPM 370. Außerdem war Heinz Richters Buch "Radiopraxis" hilfreich. Gut verständlich für die
Meßvorgänge auch "Röhrenmeßgeräte in Entwurf und Aufbau" von H. Schweitzer.
Ähnlich wie beim Funke W 20 gestattet mein Eigenbau eine Glimmlampen-Kurzschlußprüfung vor dem
eigentlichen Meßvorgang, um Kurzschlüsse durch kaputte Röhren an den Netzteilen zu verhindern. Aus diesem
Grund habe ich das äußere diesem Gerät nachempfunden. Reizvoll auch das "Programmieren" des Gerätes
durch Prüfkarten!
Mein Gerät ist in einem Sperrholzkasten mit den Maßen 50 x 50 x 22 cm eingebaut. Wegen des "Eisens" in den
Netzteilen wiegt es auch 17 kg. Links ist ein großes Fach für Zubehör und selbstgedruckte Prüfkarten.
Unerläßlich ist eine Datensammlung, z.B. der Röhren-Codex von 1948 und die spätere
Röhren-Taschen-Tabelle aus dem Franzis-Verlag.
Die Bedienplatte aus 4mm-Hartpapier (Kunststoff-Großhandel) ist dem W 20 nachempfunden.
Drei große Drehspulinstrumente gestatten das Ablesen von Anoden- und Schirmgitterspannungen, Anoden- und
Schirm-Gitterströmen und Steuergitterspannung und -strom. Diese Spannungen werden ganz altmodisch mit keramischen
Drahtpotis (bis 40 W) eingestellt. Beim Heizkreis sind Spannung und Strom verantwortungsvoll über Drehspulinstrumente
einstellbar.
Die Heiztrafos werden allerdings primärseitig und ganz modern über induktive Dimmer (Conrad) geregelt.
Das alles läuft auf einem Steckbrett mit 2 x 9 Schaltbuchsen (Bürklin) zusammen. Die Zuleitungen zum Steckbrett
enthalten Kurzschlußstecker, damit zusätzlich von außen weitere Schaltelemente hinzukommen können
(z.B. Kennlinienaufnahme mit Oszillograph!). Auch die Heiz- und Anodenspannung ist über Buchsen zu Messen und zu
Kontrollieren bzw. zu Eichen.
Die 3 großen Drehspulinstrumente (100 µA) habe ich - genau wie die 2 kleinen - neuen Meßbereichen angepaßt:
Für die Vorwiderstände Trimmer, für die Shunts am besten Widerstandsdraht und etwas Probieren.
Die Messung des Steuergitterstroms ist wegen des Instrumenteninnenwiderstands bekanntlich etwas heikel. Er
durchläuft einen 62 Ohm-Widerstand, bei dem dann der Spannungsabfall gemessen wird. Dieser ist ja dem Strom
proportional.
Mein Gerät gestattet also - genau wie die großen Vorbilder - die Anfertigung von Kennlinien mit hinreichender
Genauigkeit. Die Bedienplatte habe ich mit den wichtigsten Sockel-Buchsen versehen, für Erweiterungen ist noch etwas
Platz.
Das Steckfeld besteht aus 63 "Schaltbuchsen" auf Hartpapier im Rastermaß 16 mm geschraubt. Schaltbuchsen sind wie
Bananenbuchse, nur mit 2 isolierten Hälften. Wenn man einen 4 mm-Stecker oder -Stift hineinsteckt, wird der Kontakt
geschlossen. Ich habe die Buchsen von Bürklin zu ca. 1 € pro Stück bezogen. - Das ist nicht gerade billig, spart
aber auch Zeit.
Wie ich feststellte, benutzen andere "Röhrenprüfer" elektronisch stabilisierte Spannungen, die das Nachregeln
überflüssig machen. Das ist m.E. nach eine Philosophie-Frage. Wir sitzen doch auch gerne im Bastelkeller, oder?
Die Röhrenelektroden führen außerden - nach Heinz Richter - über 4 Kondensatoren und
(Stell-)Widerstände zu 4 Buchsen. Damit kann z.B. eine Röhre "dynamisch" getestet werden. Bei einer HF-Schaltung
dürfte das allerdings nicht funktionieren, da im Gerät etliche Meter Schaltdraht koppelnd verbaut sind.
Mein RPG hat schon viele Dutzend Prüfungen hinter sich und funktioniert zur vollsten Zufriedenheit. Noch nicht
verschaltet sind Röhrengleichrichter-Stromversorgung und dynamische Messung.
Mein Gerät ist bewußt in alter Technik gehalten. Da es wohl keine käuflichen Heiztrafos mit allen
gängigen Spannungen mehr gibt, und mir das Wickelnlassen zu teuer erschien, ging ich hier ausnahmsweise eine modernen
Weg: Ein Dimmer für induktive Lasten regelt die 2 Heiztrafos ohne Wärmeverlust. Der Anodentrafo von Jan
Wüsten ist für Verstärker gedacht und besitzt zwei 350-V-Wicklungen. Der Anodenstrom wird also mit einer
EZ 80 Gleichgerichtet. Da man die eigentliche Messung mit dem Einstellen der Steuergitterspannung beginnt, hat die
Gleichrichterröhre auch etwas Zeit zum Aufheizen! Am Ausgang des Heizkreises steht Gleichstrom zur Verfügung.
Auf meinen Prüfkarten ist das jeweilige Sockelschaltbild der Röhre abgebildet. An Daten ist nur das Notwendige
zum Bedienen und Ablesen der Regler und Meßgeräte ausgedruckt. Detailiertere Daten finde ich im Nachschlagewerk.
Die Gütebeurteilung braucht m.E. nicht auf der Prüfkarte ausgedruckt zu sein. Nach dem Gütemaßstab des
W 20 kann man eine kleine Prozentrechnung doch notfalls im Kopf, oder?
Für die Prüfkarten habe ich mir im Schreibwarenhandel 300g-Karton - den es in mehreren Farben gibt - besorgt. Auf
einer Papierhebelschere wurden die Karten per Anschlag auf Maß geschnitten. Mit einer Schablone markierte ich dann an den
betreffenden Stellen die Stanzlöcher. Dann habe ich das Sockelschaltbild aus eingescannten Seiten der
Röhren-Taschen-Tabelle "ausgeschnitten" und im Bildbearbeitungsprogramm unter "Druckvorschau" auf die entsprechende
Größe gebracht und per Randskala an die betreffende Stelle platziert. Den Schreibtext schrieb ich in "Word" und
jagte die Karte noch zweimal - einmal so rum und einmal so rum - durch den Drucker. Da alles wesentliche abgespeichert ist,
geht das sehr schnell.
Der Prüfschalter ist aus zwei alten Porzellan-Wellenschaltern zusammengebastelt. Er hat 4 Ebenen. Solche Dinger sind
heute schwer zu bekommen. Der Umschalten der Heizspannungen (hohe Ströme!) ist ein käuflicher (Conrad). Um die
Kontakte zu entlasten, habe ich 4 Schaltkontakte jeweils parallelgeschaltet.
Ein gutes Finish der Bedienplatte versteht sich von selbst. Für die Meßinstrumente habe ich neue Skalen
angefertigt. Entsprechend der benötigten Teilung machte ich eine Zeichnung in doppelter Größe. Nach dem
Einscannen druckte ich die Skala auf Fotopapier. Die Beschriftung der diversen Schalter ist invertiert auf Silberfolie
gedruckt. Die habe ich dann auf 1 mm-Aluschildchen geklebt. Das macht sich ganz gut und sieht professionell aus.
Technische Daten:
Heizspannung: 0 - 6 V, 0 - 24 V, 0 - 60 V, 0 - 115 V
Steuergitter: 0 - 55 V negativ
Anode und Schirmgitter: je 0 - 300 V / 150 mA
Herstellung dieses Koffers:
1. Seitenteile aus 12 mm Pappelsperrholz sauber zuschneiden und fingerverzahnen, dazu mit der Bandsäge Einschnitte
machen (12 mm breit). - Kann man auch stumpf verkleben und dann verdübeln. Mit Anschlagwinkel verkleben, Kanten
verschleifen.
2. Zwischenwand einpassen, verkleben und verdübeln.
3. Jetzt genau Maße für die Bedienplatte abnehmen.
4. Boden aus 4 mm Pappelsperrholz aufschrauben und Deckelplatte aufkleben.
5. Nach dem Trocknen (!) ca. 3 cm breit mit schmalem Blatt auf der Tischkreissäge Deckel bis auf die Ecken absägen.
Den Rest mit der Handsäge machen. Kanten verschleifen.
6. Beizen und mit "Schnellschliffgrund" grundieren. Dann Zellulose-Nitrolack 3 mal. Zwischendurch immer schleifen.
Noch ein Tipp zum Beschleifen der Kanten und Ecken von Kästen:
Man kann sich aus kleinen und großen Spanplattenstücken Schleifklötze machen. Schleifbänder für
Schleifmaschinen besorgen und Stücke davon mit Pattex aufkleben.
Prüfanleitung
Die folgende Prüfanleitung ist natürlich längst nicht so detailliert wie die eines Funke- oder
Neuberger-Gerätes. Wenn man ein solches Gerät baut, hat man sich vorher eingehend mit der Literatur beschäftigt.
Mein Gerät ist aus diesem Grund auch nicht so sehr ßprogrammiertß wie die großen Vorbilder. Als ich
die erste Röhre testete, hatte ich vorher sorgfältig alle Spannungen gemessen. Außerdem steckte ich nicht
gleich die älteste und wertvollste Röhre in die Fassung. Das versteht sich. Röhren testen oder vermessen
sollte man nur, wenn man Zeit und Ruhe hat.
1. Prüfkarte auflegen und Stifte stecken.
2. Wenn keine Prüfkarte zur Hand, Stifte nach Sockelschaltung stecken.
3. Alle Kippschalter und Drehschalter sind in linker Stellung. Prüfschalter in Stellung 1 (Aus). Netzschalter Ein.
4. Prüfschalter in Stellung 2 bringen, Glimmlampe ßSchlußprüfungß muß jetzt
aufleuchten, wenn der Heizfaden in Ordnung ist. Sonst Prüfung abbrechen!
5. Falls der Heizfaden in Ordnung ist, weiter auf Stellung 3 und dann auf Stellung 4.
6. In Stellung 4 kann man - falls gewünscht - die Heizspannung nach Prüfkarte einstellen. Die Röhre wird
jetzt geheizt. Beim Weiterdrehen machen sich jetzt thermische Schlüsse bemerkbar.
7. Langsam bis Stellung 10 weiterdrehen. Hierbei darf die Glimmlampe nirgends aufleuchten. Andernfalls hat die
Röhre einen Schluß zwischen den Elektroden und ist unbrauchbar. Dann muß die Prüfung abgebrochen
werden.
8. Falls bis hierher alles in Ordnung ist, Heizspannung auf 0 drehen. Anschließend werden die Meßbereiche
nach den Werten der Prüfkarte vorgewählt. Dann den Prüfschalter bis Stellung 12 weiterdrehen. Jetzt kommt
die statische Messung.
Zuerst wird die negative Steuergitterspannung eingestellt. Dann ist eventuell die Schirmgitterspannung an der Reihe.
Jetzt die Anoden-Spannung einstellen. Zum Schluß die Heizspannung vorsichtig auf Wert hochdrehen und den Heizstrom
beachten. Dieser schnellt zunächst etwas hoch um dann auf den Sollwert zu sinken.
9. Wenn die Röhre aufgeheizt ist, muß der Anodenstrom steigen. Jetzt eventuell die anderen Spannungen
nachregulieren. Beim weiteren Hochdrehen der Steuergitterspannung, wird der Anodenstrom zurückgehen. Nach der
Literatur ist die Röhre noch als gut zu bezeichnen, wenn Ia 60% des Sollwertes erreicht. Bei nur 40% ist die Röhre
unbrauchbar.
10. Zur Vakuumprüfung entsprechende Taste drücken. Der Anodenstrom darf sich nicht wesentlich ändern,
sonst herrscht nur noch ein schlechtes Vakuum, das Steuergitter läd sich von selbst negativ auf und die Röhre ist
unbrauchbar.
11. In Stellung 12 lassen sich ebenfalls Kennlinien erstellen. Beispielsweise erhöht man zur Erstellung einer
Ug1/Ia-Kennlinie die Steuergitter-Spannung schrittweise um je 1 V und liest jeweils den Anodenstrom ab. Dabei ist
ständiges Nachregeln aller übrigen Spannungen erforderlich. Mehr über das Thema Kennlinien sollte man der
Literatur entnehmen. Grundsätzlich gilt dabei immer, daß man eine Spannung schrittweise erhöht und den
zugehörigen Stromwert dann abliest.
Es empfiehlt sich die Werte in eine vorbereitete Tabelle zu schreiben. Die Kurve zeichnet man dann später auf
Millimeterpapier.
12. Steile Endröhren neigen mitunter zur Selbsterregung. Diese Schwingungen können verhindert werden, wenn
unmittelbar am Gitteranschluß der Röhre ein Entkopplungswiderstand von 1000 Ohm eingefügt wird. Dazu den
Kurzschlußstecker der Gitterzuleitung entfernen und einen 1000 Ohm-Stecker einsetzen. Auch Ferroxcube-Perlen sind
hilfreich.
Es ist wichtig, etwaiges Schwingen der Prüfröhre zu erkennen. Beim Schwingen von Prüfröhren zeigt das
RPG-Müller folgende Erscheinungen: Der Anodenstrom steigt von einem bestimmten Wert an meist ruckartig bis weit
über den normalen Wert an. Die Anzeige der negativen Gitterspannung steigt ebenfalls an, ohne daß das
zugehörige Regelorgan betätigt wird. Beim Drücken der Vakuumtaste fällt der Anodenstrom stark ab.
13. Misch- und Oszillatorröhren erreichen bei der statischen Messung nicht den in der Tabelle vorgegebenen
Richtwert des Anodenstroms. Die angegebenen Gittervorspannungen bei Oszillatorröhren müssen für die statische
Prüfung ihrem Wert nach auf ca. die Hälfte bis ein Drittel verringert werden. Bei einer Gittervorspannung Null ist
erfahrungsgemäß der Anodenstrom ungefähr dreimal so groß als der mittlere Anodenstrom im Schwingbetrieb.
Dies gilt auch für Mischröhren.
14. Röhrenmessungen mit einer Gittervorspannung Null, z.B. bei der Kennlinienaufnahme, sind vorsichtig und
möglichst kurzzeitig durchzuführen, um Beschädigungen der Prüfröhren durch Überlastung zu
vermeiden. Röhren, deren Gittervorspannung in der statischen Tabelle mit Null angegeben ist, zeigen nur den richtigen
Anodenstromwert an, wenn die Gitterspannung über hochohmigen Widerstand zugeführt wird. Durch Drücken der
Vakuum-Taste kann dieser notwendige Hochohm-Widerstand eingetastet werden. Ohne denselben würde die Röhre einen
sehr viel größeren Anodenstrom anzeigen.
15. Will man Röhren genau beurteilen, wird die Steilheit der Gitter-Anoden-Kennlinie bestimmt. Die Messung erfolgt
so:
Bei einer bestimmten Anodenspannung Ua wird bei einer negativen Steuergitterspannung Ug1 der Anodenstrom Ia1 festgestellt.
Nun stellt man bei gleicher Anodenspannung Ua eine höhere negative Gitterspannung Ug2 ein und mißt wiederum den
Anodenstrom Ia2. Die Steilheit ergibt sich zu:
Die Anoden-, Schirmgitter- und Heizspannungen müssen während der gesamten Messung exakt konstant gehalten werden.
16. Der Durchgriff D wird so bestimmt:
Bei einer bestrimmten Anodenspannung Ua1 (z.B. 200 V) und einer bestimmten negativen Gittervorspannung Ug1 ergibt sich
ein bestimmter Anodenstrom Ia. Wählt man nun eine zweite, z.B. um 50 V niedrigere Anodenspannung Ua2, so sinkt
naturgemäß der Anodenstrom. Nun wird die negative Gittervorspannung so verändert, daß sich wieder der
ursprüngliche Anodenstrom Ia einstellt. Dieser zweite Gittervorspannungswert sei Ug2.
Der Durchgriff ist dann:
(D = 8 % bedeutet, daß eine Änderung der Anodenspannung Ua um 100 V nur ebensoviel ausmacht, wie eine
Änderung der Gitterspannung Ug um 8 V.)
17. Zur Bestimmung des Inneren Widerstandes Ri werden bei einer Gittervorspannung Ug und einer
Anodenspannung Ua der Anodenstrom Ia festgestellt. Bei einer niedrigeren Anodenspannung Ua2 und der gleichen
Gitterspannung Ug wird ein Anodenstrom Ia2 gemessen.
Dann ist der innere Widerstand der Röhre:
18. Zum Prüfen von Gleichrichterröhren werden im Gerät fest einstellbare Wechselspannungen (100 V und
350 V) verwendet. Ein Einregeln von Spannungen gibt es nicht. Nach der Schlußmessung erfolgt die Prüfung in
Stellung 11 oder 12.
Zur Vorbereitung der Messung entfernt man den Brückenstecker aus dem vordersten Buchsenpaar. Jetzt ist die Heizung
der Netzteilröhre EZ 81 ausgeschaltet.
Dann steckt man den Brückenstecker entweder in das Buchsenpaar 100 V~ oder 350 V~, je nach dem, welche Röhre
getestet werden soll. Anschließend wählt man den Belastungswiderstand, links beim schwächsten Strom
beginnend. Es darf bei den drei Buchsenpaaren nur ein Brückenstecker verwendet werden.
Nach dem Einregeln der Heizspannung wird der Drehschalter S20 soweit nach rechts gedreht, bis der Sollwert des
Anodenstroms nach Prüfkarte bzw. Tabelle erreicht ist. Wird er nicht erreicht, ist die Röhre unbrauchbar.
Ein Prüfen der Röhre auf Steuerwirkung gibt es nicht, da Gleichrichterröhren kein Steuergitter besitzen.
Deshalb ist auch eine Vakuum-Prüfung belanglos.
Bei Röhre mit zwei Systemen prüft man nach Prüfkarte jedes System getrennt.
Es folgenden die Schaltpläne
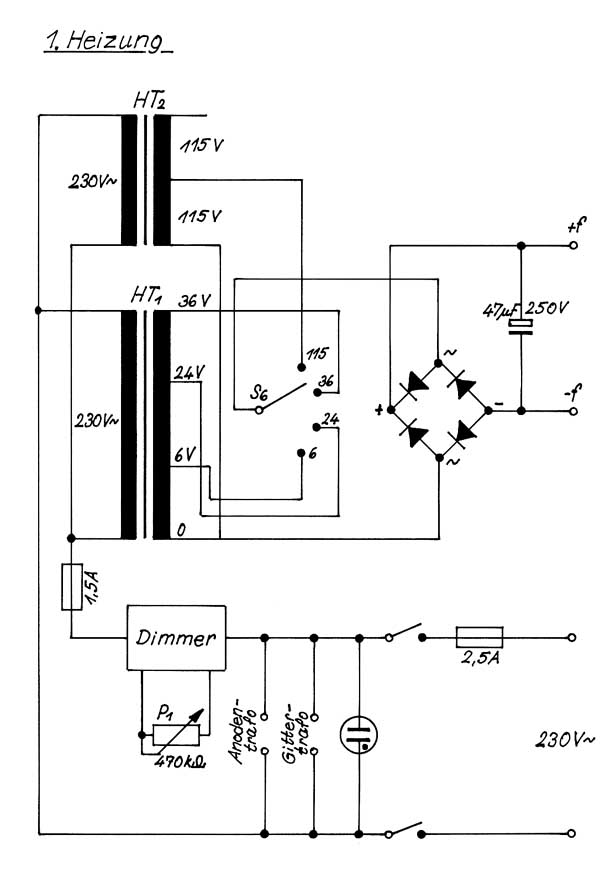
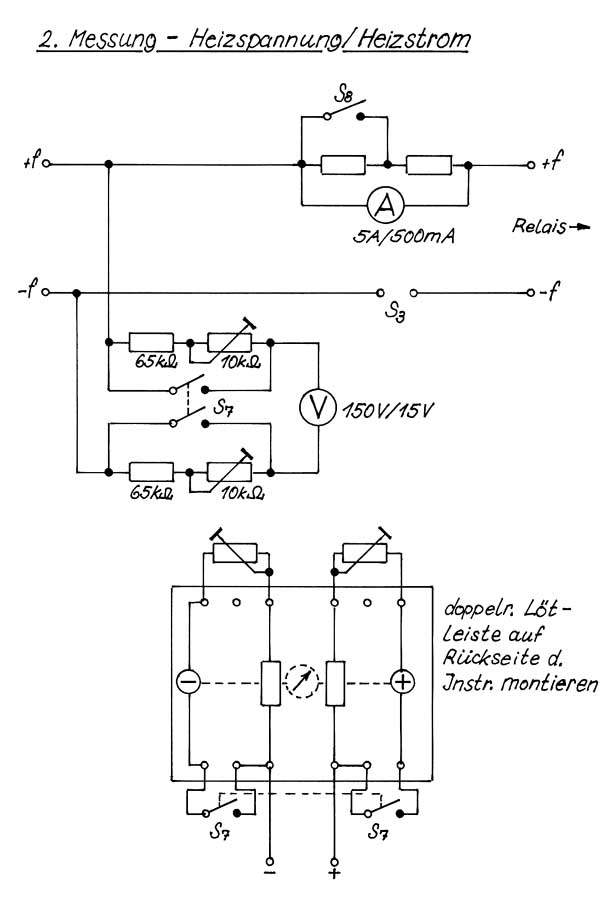
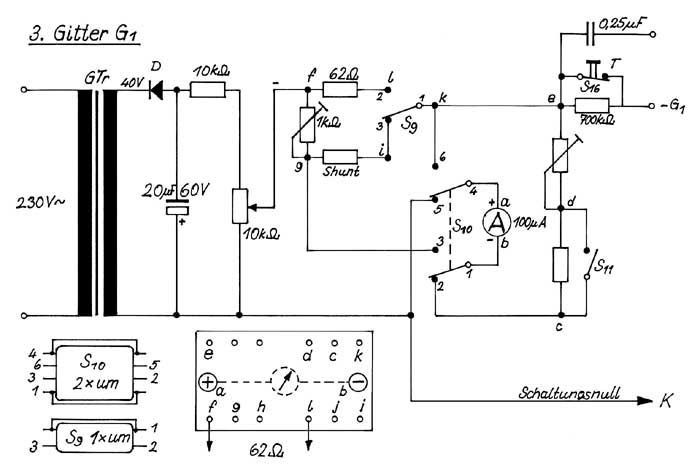
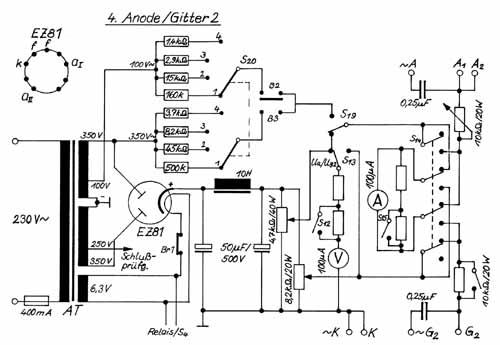 (Mit der Maustaste das Schaltbild anklicken, es wird dann in voller Auflösung dargestellt.)
(Mit der Maustaste das Schaltbild anklicken, es wird dann in voller Auflösung dargestellt.)
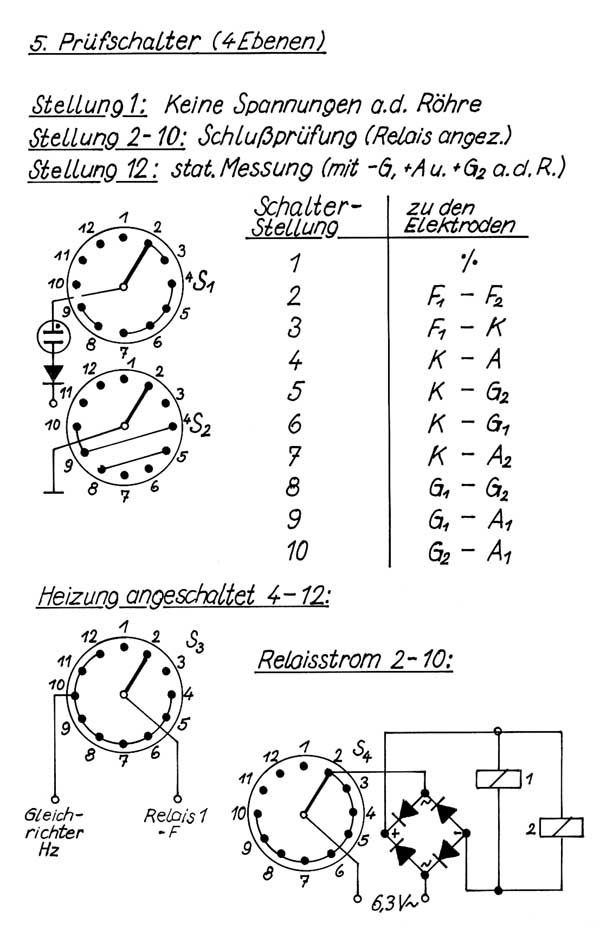
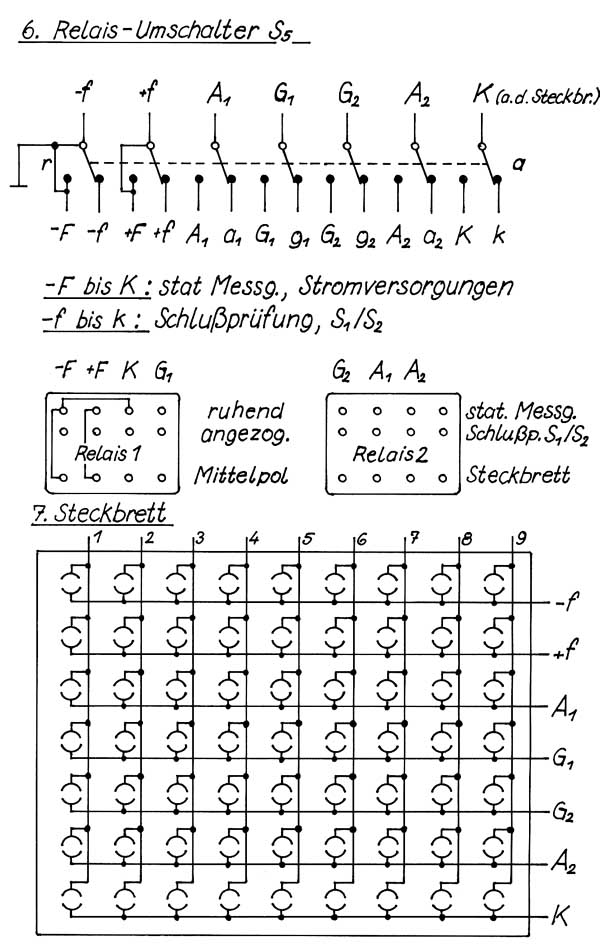
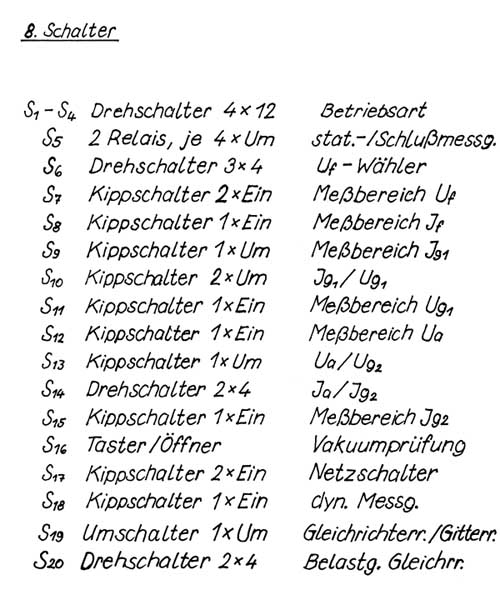
Es folgt eine Übersichtstafel der kompletten Bedienplatte, anschließend eine Tabelle mit der Zeichenerklärung
zur Bedienplatte.
Gruss, Rolf Müller